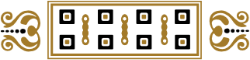Wie die giftig grüne Lichtsäule, die aus Minas Morgul in den Himmel schießt, um das Ende des Dritten Zeitalters einzuläuten, so verbreitete Amazon schon vor dem Start von “Die Ringe der Macht” wokenessgesättigte Teaser, die in der Fangemeinde Angst und Schrecken verbreiteten. Sollte nach Star Wars, Ghostbusters und vielen anderen nun auch das tolkiensche Universum zeitgeistgerecht geschändet werden, um wie ein Feldzug von Sauron nichts als verbrannte Erde, Ruinen und bittere Tränen zurückzulassen? Das stand zu befürchten und wir Freunde Mittelerdes wälzten uns lange schon nachts in unruhigen Träumen in den Betten, lasen das kommende Unheil bereits während ruheloser Nachtspaziergänge an der blutroten Farbe der Dämmerung ab.
Und in der Tat bestätigt der erste Eindruck zunächt einmal alle Befürchtungen und hinterlässt auch den gleichgültigen Zuschauer irgendwo zwischen Gelächter und Kopfschütteln. Denn die Schwarzen sind überall — als schwarzer Elbenkrieger in den Südlanden, als schwarze Zwergenfrau, als schwarzer Hobbitrentner mit weißem Haar und als schwarze numenorische Prinzessin. Mittelerde ist endlich divers geworden. Wo kein Schwarzer plaziert ist, wartet in der Regel dann eine Frau. Die Hauptrolle ist selbstredend mit Galadriel weiblich besetzt, und aufgrund des Männerüberschusses in Tolkiens Geschichten wurden zusätzlich starke, weibliche Rollen wie Durins Ehefrau Disa oder die ehrgeizige Eärien als zusätzliche Tochter Elendils hinzuerfunden. Weiße Männer dagegen trifft man eher als Bremser, Nullen, Weicheier, die regelmäßig von Schwarzen und Frauen gerettet, aufgerüttelt, ermahnt werden müssen.
So weit, so gut — an dieser Stelle endete bislang die Auseinandersetzung der meisten Rezipienten und daß Amazon es mit eitlem Sendungsbewußtsein darauf anlegt, so viele ehrliche Anhänger Tolkiens mit zeitgeistiger Politisierung zu verprellen, ist fraglos kein schöner Zug. Am Ende der ersten Folge allerdings, der ich noch primär aus Kuriosität beiwohnte, um das Skandalon der Saison zu betrachten wie einen Echsenmenschen im Zirkus, geschah das Unerwartete: irgendetwas an dieser Serie gefiel mir, riss mich mit, machte mir mir Neugier auf die zweite Folge. Hier nun, deutlich wohlwollender gestimmt, fiel mir zunächst und erstmals die ungemein schöne Titelanimation auf. Von elegisch-schicksalssschwangeren Streichern begleitet formt kreisender Staub sich zu archaischen Mustern und Ornamenten. Und es will mir nun scheinen, als ob diese Animation bereits bewusst den ästhetischen Stil der Serie ausdrückt, gewissermaßen eine realistische Textur in den Details mit dem fantastischen Gewebe von Tolkiens epischer Gegenwelt verbindend. Denn eigenwillig schwankend, in diesem Schwanken aber immer auch eine gewisse Spannung erzeugend, so tritt einem diese Serie entgegen, märchenhaft poetische Bilder treffen auf ein außerordentlich irdisch, menschlich, lebensvoll gezeichnetes Handeln und Wirken.
Und darin liegt, sofern man sich imstande findet, die aufdringlich plazierte Identitätspolitik zu tolerieren, die eigentliche Überraschung: obwohl die Aufgabe keine leichte ist, da doch das Silmarillion zumeist nur mit den groben Strichen einer Chronik die frühgeschichtlichen Verhängnisse Mittelerdes schildert, leisten die Autoren tatsächlich ausgezeichnete Arbeit darin, das karge Erzählskelett mit Leben zu füllen. Speziell die Charakterzeichnung fällt so glaubwürdig wie vielschichtig aus. Wo Hauptfigur Galadriel im Herrn der Ringe schließlich so uralt, wissend und mächtig geworden ist, daß sie etwas Beängstigendes, geradezu Grausames, Unmenschliches auszustrahlen beginnt, tritt uns, psychologisch nicht unplausibel, die junge Galadriel als burschikoser Wildfang entgegen, genauso humorlos wie ihr älteres Ich, doch voller jugendlicher Energie, hitzig, wütend, rachedurstig. Auf Jung-Elrond stoßen wir als ironischen Tändler, talentiert, etwas verlogen — ein aufstrebender Jungppolitiker, der bereits den laschen, redegewandten Opportunisten, wie Tolkien ihn im Herrn der Ringe schildert, in sich trägt.
Auch die Dialoge beeindrucken durch Stilsicherheit, halten die Balance zwischen Alltagssprache und einem etwas förmlich-blumigeren Altvorderenton. Hier zeigt sich “Die Ringe der Macht” sogar deutlich stärker als Peter Jacksons Trilogie, worin die Dialoge nicht nur einmal die Grenze zum Peinlich-Gestelzten überschreiten und kaum über ein blasses Abarbeiten der Vorlage hinauskommen. (Und man erinnere sich nur an die Überflüssigkeiten, mit der er den “Hobbit” aufbläst.) So erschafft “Die Ringe der Macht” glaubhafte Charaktere mit glaubhafter Motivation, die auch ein traditioneller Tolkien-Anhänger als stimmige Interpretation von Mittelerde auffassen kann. Keine geringe Leistung.
All das geschieht allerdings um den Preis einer Verwandlung. Wo uns “Die Ringe die Macht” direkt in das vor Leben, vor Intrigen, Feindschaften, Ambitionen, größenwahnsinnigen Plänen und geheimnisvollen Fremden nur so strotzende Mittelerde hineinzuwerfen vermag, verblasst ein anderes Mittelerde, das epische, mythische Mittelerde, wie es mir von meiner eigenen Lektüre des Silmarillions in Erinnerung ist. Hier umfängt einen nun ein grübelnder Seelenschmerz, der die Gedanken ganz an den Grund hinab zieht.
Denn: was ist Mittelerde eigentlich? Der Traumkosmos eines fantasievollen Sprachgenies, das bereits in seiner Jugend Sprachen wie Gotisch und Altgriechisch beherrscht und als Altphilologe sein Leben damit verbringt, sich in uralte, vergessene Skripe zu versenken, sie aus ihrem geschichtlichen Kontext heraus zu deuten. Seine akademische Reputation verdient Tolkien sich mit einer Neuedition von “Sir Gawain and the Green Knight”, ein im 14. Jahrhundert in Stabreimen abgefasstes Heldenepos und den größten Teil seines Lebens verbringt er als Professor für Anglistik in Oxford. Diesen Hintergrund, diesen Bildungs- und Interessenshorizont spürt jeder, der das “Silmarillion” liest. Tolkien erzählt nicht lediglich spannende Märchen, er entwirft eine eigene Kosmologie, eine mythische Sammlung fiktiver Frühgeschichte, von der Weltschöpfung bis in die Gegenwart, die ähnlich der Bibel so etwas wie den Überlieferungskanon einer fiktiven Kultur formt. Und er greift dafür immer auch auf reale Vorbilder zurück, was den Ton, die Konstellation, die Motive betrifft. So erhält sein Werk eine Tiefe, das seine Nachfolger — denn erst dadurch erschafft er das Genre, das wir heute als “Fantasy” bezeichnen — bis heute zumeist nicht annähernd erreichen. Irgendetwas in Tolkiens Werk ist mehr geworden als ein Spiel, der bloß exzentrische Spleen eines englischen Professors, er berührt tiefere Saiten in uns und macht so die meist in jungen Jahren erfolgende Lektüre auch heute noch für viele zu einem prägenden Erlebnis, das einen lebenslang nicht mehr verlässt.
So entfacht diese Verfilmung ironischerweise gerade in dem, worin sie gelungen ist, einen grundsätzlichen Konflikt. Umso menschlicher und nahbarer, umso nachvollziehbarer in ihren Leidenschaften uns die Charaktere des Zweiten Zeitalters geschildert werden, so verschwindet gleichzeitig auch etwas — nennen wir es das Erhabene, ein bestimmtes, feierliches Pathos, die heroisch-tragische Distanz zu den großen kosmischen Schicksalsmomenten, die das Wesen klassischer Epik ausmachen wie auch einen nicht unerheblichen Teil des Reizes des Silmarillions. In der Wandlung zum Mythos wird Mensch und Geschehen dem bloß Profanen und Individuellen enthoben, wird Teil einer Erzählung, die weniger über ihn selbst als vielmehr über die Beschaffenheit der Ordnung aussagt, die sie weitergibt — in der Vermenschlichung dagegen verblasst dieses Höhere wieder.
Dabei, und nun wird es langsam interessant, ist dieser Zwiespalt weniger der Unzulänglichkeit der Autoren zuzurechnen, sondern bereits Tolkien besitzt ein klares Bewußtsein dafür. An einem zentralen Moment der Geschichte, dem Zeitpunkt, als Frodo und Samweis den Pass von Cirith Ungol erreicht haben, der den Eingang in das lebensfeindliche, verheerte Mordor bedeutet, lässt Tolkien die beiden über Heldensagen sprechen. “Die tapferen Taten in den alten Geschichten und Liedern, Herr Frodo: Abenteuer, wie ich sie immer nannte. Ich glaubte, das wären Taten, zu denen die wundervollen Leute in den Geschichten sich aufmachten und nach denen sie Ausschau hielten, weil sie es wollten, weil das aufregend war und das Leben ein bißchen langweilig, eine Art Zeitvertreib, könnte man sagen. Aber so ist es nicht bei den Geschichten, die wirklich wichtig waren, oder bei denen, die einem im Gedächtnis bleiben. Gewöhnlich scheinen die Leute einfach hineingeraten zu sein — ihre Wege waren nun einmal so festgelegt, wie du es ausdrückst. Aber ich nehme an, sie hatten eine Menge Gelegenheiten umzukehren, wie wir. Nur taten sie es nicht. Und wenn sie es getan hätten, dann wüssten wir’s nicht, denn dann wären sie vergessen worden. Wir hören von denen, die einfach weitergingen — und nicht immer alle zu einem guten Ende, wohlgemerkt.”
Und so trösten und motivieren die beiden sich in der Gefahr, ihr Leben auf qualvolle Weise zu verlieren mit der Aussicht, vielleicht dadurch am Ende selbst Teil der Geschichten zu werden, die sie selbst so gerne gehört haben. “Immerhin wüsste ich gern, ob wir jemals in Liedern oder Geschichten vorkommen werden. Wir sind natürlich in einer; aber ich meine: in Worte gefasst, weißt du, am Kamin erzählt oder aus einem großen, dicken Buch mit roten und schwarzen Buchstaben vorgelesen, Jahre und Jahre später. Und die Leute werden sagen: ‘Lass uns von Frodo und dem Ring hören!’ Und sie werden sagen: “Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Frodo war sehr tapfer, nicht wahr, Papa?’ — ‘Ja, mein Junge, der berühmteste der Hobbits, und das sagt viel.’ ” Damit ist bereits der Herr der Ringe in seinem Aufbau zwiegespalten: in Aragorn, den verlorenen Königssohn, als klassischen Helden, und Frodo und Samweis als Anti-Helden, vielleicht auch als Tolkiens eigenes, modernes Bewußtsein, die Kluft zwischen Wirklichkeit und Überlieferung immer bereits reflektierend.
Es wird Frodo sein, der in Tolkiens Erzählung die Geschichte des Ringkriegs niederschreibt, nicht Aragorn, der Teil der Geschichte ist, Teil des sich vollziehenden, geschichtlichen Schicksals, von dem er selbst gar kein Bewußtsein besitzt, weil er es als Figur ausdrückt. Zwar fügen auch Frodo und Samweis sich dem Schicksalssog, doch bereits als moderne Menschen aus einem klaren Bewußtsein, aus zwar zögerlicher, ängstlicher, aber doch vernünftiger Entscheidung heraus, die Distanz ihrer selbst zur Welt der Helden immer klar vor Augen. Wo das untergehende Mittelerde des Dritten Zeitalters noch der Welt des Abenteuers, der Drachen, Trolle und Ungeheuer angehört, so schwimmt darin das Auenland als Nachbildung des braven, englischen Kleinbürgertums, dem Tolkien selbst entstammt, die Mentalität der Hobbits ist sichtlich immer auch eine ironische Karikatur der damaligen englischen Gesellschaft.
Aragon als klassischer Held bewegt sich durch den Herrn der Ringe wie ein Schlafwandler, wie eine Marionette, die von einem unsichtbaren, längst gezogenen Schicksalsfaden bis an sein bereits seit Äonen feststehendes Ziel geleitet wird. Er ist ganz eins mit seinem Schicksal, es liegt nicht in seinem (von Tolkien so konzeptionierten) Wesen, es zu hinterfragen, problematisieren oder abzulehnen. So bleibt unser Verhältnis zu ihm bis zuletzt von einer charakteristischen Distanziertheit. Sein Dasein als klassischer Held macht ihn uns zum Wunschbild, zum idealen Vorbild, doch löscht die Idealität seiner Rolle seine Individualität und damit seine Menschlichkeit weitgehend aus. Er besitzt keine Persönlichkeit im eigentlichen Sinn, kein Innenleben, das irgendeiner Schilderung wert wäre, sondern steht so perfekt wie steril als Ansammlung der Idealeigenschaften eines Kriegers und Königs vor uns, während er als bloßes Bedeutungs-Medium die ihm von Anbeginn seiner Existenz eingeschriebene Bestimmung vollzieht. Sogar seine Liebe zu Arwen wird bereits zum Zeitpunkt des Erzählens auf eigenartig seelenkalte Weise vermythologisiert, der authentischen menschlich-emotionalen Züge beraubt und so der Weltgeschichte eingeschrieben.
Aus Frodo und Samweis dagegen spricht ganz das moderne Bewußtsein, die moderne Figur des Anti-Helden, die ihren Reiz gerade aus dem Gegenteil, der Individualität, der Gewöhnlichkeit und Normalität des Protagonisten zieht. Hier ist plötzlich eine ganz andere Art von Sympathie und Identifikation möglich, wenn wir Frodo und Samweis bei ihrem unbeholfenen Vorwärtsstolpern beobachten, stets überfordert, grübelnd, zögerlich, um am Ende sich ganz im Ethos der Moderne doch emporzuschwingen zum Entschluß, zur Selbstüberwindung als Ausdruck individuellen Charakters, das schicksalshafte Sein des heldischen Aragorn am Ende durch ein zähes Werden im Profanen doch irgendwie überkränzend.

Auf die Spannung dieser beiden Pole stößt der Betrachter auch in “Die Ringe der Macht”, verwandelt allerdings in die Distanz der Epochen von Entstehung und Verfilmung. Nicht unrelevant dürfte sein, daß Tolkien, geboren 1892, lediglich drei Jahre älter als ein Ernst Jünger (und drei Jahre jünger als Adolf Hitler) ist. Er ist Teil der Generation, die in Deutschland die “Konservative Revolution” und überall in Europa jene antimodernen Politikkonzepte entwirft, die heute gemeinhin als “Faschismus” zusammengefasst werden, einer Generation, die auf vielfältigste Weise in einem Zwiespalt mit der entzauberten, rationalistischen Moderne des 19. Jahrhunderts steht, der sie selbst entstammt.
Doch während im Faschismus die Neuverbindung von modernem und vormodernem Bewußtsein durch die Synthetisierung von Massengesellschaft und Technik einerseits und der Reaktivierung von Herrschafts‑, Krieger- und Schicksalsmythen andererseits mittels Politik versucht wird, wählt Tolkien die Kunst für eine vergleichbare Grundkonstellation und erschafft auf diese Weise die für sein Werk charakteristische Doppelung von Held und Anti-Held, von Epos und Bürgertum, auf die wir sowohl im Herrn der Ringe als auch im Hobbit (dort Bilbo und Thorin Eichenschild) stoßen. (Auch bei C.S. Lewis, seinem Autorenkollegen und Freund, muss die Kluft zwischen modernem und mythischen Bewußtsein geschlossen werden, in diesem Fall durch eine geheime Tür, die in eine schicksalsdurchwobene Sagenwelt führt.)
Diese heimliche Seelenverwandtschaft ist möglicherweise der Grund, wieso Tolkien sich im rechten Spektrum, von Varg Vikernes bis Georgia Meloni, einer so anhaltenden Beliebtheit erfreut. Doch trotz ähnlicher Gestimmtheit ist der Ton Tolkiens schlußendlich ein ganz anderer als der konservativen Revolutionäre seiner Zeit. Es ist ein ironischer Ton, mit dem er seine Hobbits in das gefährliche Mittelerde hineinwirft, Ausdruck einer Haltung, die man vielleicht am ehesten mit “Humanismus” bezeichnen könnte, getragen von melancholischem Verstehen, einem humorvollen Bejahen und Akzeptieren, das gerade den faschistischen Bewegungen der Zeit völlig fremd ist. Das moderne, gegenwartsbejahende Bewußtsein behält die Oberhand und lässt die Welt von Mittelerde schon während des Erzählens im Vergehen begriffen sein, mit der Zerstörung des Rings endet auch die Anwesenheit der Elben in Mittelerde und das Zeitalter der Menschen zieht herauf. Wo man in den Schriften der Weimar-Rechten ein regelrechtes Entsetzen, ein Nicht-Ertragen-Können der Gegenwart vernimmt, dort taucht Tolkien seine Hobbitwelt lediglich in freundlichen Spott, hält sie als etwas lächerliches Refugium der Kleinbürgerlichkeit aber immer ins Herz geschlossen. Seine Helden dürfen schließlich ins Auenland in ihre behaglichen Wohnhöhlen zurückkehren, erleichtert, die erschreckende Welt des Heldenepos hinter sich gelassen zu haben. Hitler dagegen, der den Mythos als Wahrheit auffasste, zur Wirklichkeit machen wollte, legt schließlich in seinem Bunker unter dem zerstörten Berlin — bezeichnenderweise gleichzeitig mit der Niederschrift des Herrn der Ringe — noch ein letztes Mal Wagner auf und schießt sich dann in den Kopf.
(Doch auch der Ringträger trägt ein unheilbares Mal auf der Seele, das ihn der profanen Welt des Auenlandes entfremdet, eine wirkliche Rückkehr bleibt ihm verwehrt, er wird sich am Ende seines Lebens zusammen mit den Elben aufmachen nach Valinor. Ein dem “Goldenen Zweig” entlehntes Motiv, wonach das Berühren des Sakralen einen Preis fordert, oder am Ende doch das heimliche Eingeständnis Tolkiens eines tieferen Leidens?)
Und so bewegt das Zahnrad der abendländischen Geschichte sich Mitte des 20. Jahrhunderts wieder einen Zahn weiter und erschafft eine neue Generation, die nicht mehr zwischen den Welten steht, sondern mit beiden Beinen in der Moderne; eine Generation, welche die ironische Melancholie als heimliche Grundierung von Tolkiens Werk längst nicht mehr kennt. Die kommende Welt, die Welt der Menschen, wie Tolkien sie am Ende des Herrn der Ringe bereits heraufdämmern lässt, als die Elben zusammen mit seinem dem Auenland entfremdeten Alter Ego Frodo Mittelerde endgültig verlassen, diese Welt ist unsere heutige Welt, worin die Autoren der Amazon-Serie leben. Mit dem Tod der Generation Tolkiens ist auch das Lebensgefühl gestorben, das zur Erschaffung von Mittelerde führte.
Und so füllt nun die gegenwärtige Generation Tolkiens Werk, das unleugbar ja noch immer wie eine vergessene, verschlossene Truhe auf dem Speicher einen schwer deutbaren, schimmernden Zauber ausstrahlt für jeden, der ihm begegnet, mit der Vorstellung der Welt, die sie selbst in sich tragen. Es liegt eine Konsequenz darin, auch wenn sie seinen eher konservativ gestimmten Anhängern nicht gefallen dürfte. Wo ein Tolkien noch wehmütig Abschied nimmt von der vormodernen Welt der Elben, Zwerge und auserwählten Königssöhne, so ist der Abschied in “Ringe der Macht” bereits als Kulturprozess vollzogen, die unsterblichen, halbgotthaften Elben treten ganz irdisch, lebendig, kurz gesagt: menschlich vor uns. Sie existieren nun als Figuren, die “auch nur Menschen” sind, doch das eigentlich Elbische als mythenhafte Erzählpatina hat Mittelerde tatsächlich verlassen.
Galadriel erspürt nicht länger in einer mit Wasser gefüllten Schale die Tragödien der Zukunft, sondern forscht als Abenteuerin nach Spuren Saurons und organisiert militärischen Widerstand gegen ihn. Was Tolkien noch als halb spielerisches, halb ergriffenes Zitier-Spiel mit den Elementen europäischer Mythengeschichte treibt, wäre den Amazon-Autoren heute kaum noch verständlich zu machen. Der Ursprung von Gut und Böse in Valinor werden geschildert als Kindheitsepisode, worin das gute Kind ein Papierschiffchen baut und es auf dem Bach schwimmen lässt, während das böse Kind aus Neid darauf Steine wirft. Das lässt sich als schöne Symbolik auffassen, aber der Verdacht kommt auf, daß hinter der Symbolik gar nichts liegt, worauf es verweisen würde, daß wir es hier also gar nicht mit einer Symbolik, sondern einer bloßen psychologisierenden Profanisierung zu tun haben, da den heutigen Autoren entsprechende religiöse Horizonte nicht bekannt, ja nicht einmal intellektuell zugänglich wären.
Das klingt etwas bitter, aber liegt darin nun ironischweise nicht genau die Lektion, die wir von Frodo und Sam am Pass von Cirith Ungol lernen? Eine Lektion also, die uns Tolkien selbst gibt, worin seine eigene Erkenntnis ausgedrückt ist? Vollziehen Heldengeschichten sich in der Wirklichkeit nicht tatsächlich weniger als die strahlenden Triumphzüge, als die sie uns möglicherweise überliefert werden, als die mühelose Geschmeidigkeit, mit der ein Aragorn den seit Urzeiten verwaisten Thron wieder einnimmt, sondern indem ganz gewöhnliche Menschen an irgendeinem Punkt mutige Entscheidungen treffen, sich quälen, vielleicht zugrundegehen und trotz Aussichtslosigkeit doch nicht aufgeben? Wird Galadriel nicht in “Die Ringe der Macht” zum ersten Mal wirklich zu Galadriel, also zu einem wirklichen, lebendigen, individuellen Wesen?
Radikal gefragt: gewinnen wir nicht auch etwas dabei, uns Jesus nicht als Gottessohn, sondern als Menschen vorzustellen? Gewinnen wir dabei nicht das an Immanenz, was wir an Transzendenz verlieren? Wenn ich schreibe, dass das “eigentlich Elbische” verlorenginge, so ist, da Elben ja nur eine Fantasieschöpfung sind, mit dem “eigentlich Elbischen” letztlich ein Potential, eine Wahrheit des Menschen ausgedrückt, ein Fantasie-Mittler, womit der Mensch mit seiner eigenen Seele kommuniziert. Und wenn ich schreibe, daß sich der Ursprung von Gut und Böse in “Die Ringe der Macht” kaum noch als Symbol auffassen lässt, so drückt im Symbol sich lediglich ein Zusammenhang aus, der auf die Anlage des Menschen selbst verweist.
“But what ends, when the symbols shatter”? Und umgekehrt: was wird sichtbar, wenn es nicht länger durch das Symbol verdeckt wird? Die Moderne verweist den Menschen unerbittlich auf sich selbst, das macht sie so kalt und karg, das macht sie so mächtig und dynamisch, und das ist es letztlich, womit einen diese künstlerisch durchaus gelungene Interpretation des Silmarillions als Ausdruck unseres gegenwärtigen Menschseins konfrontiert. Was die Moderne dem Menschen an äußerer Ordnung, an in äußere Ordnung gewickelte Geborgenheit nimmt, das gibt sie ihm an Kraft und eigenem Vermögen, darin liegt ihr eigener Mythos, auch wenn wir diesen in der Regel kaum wahrnehmen, weil wir ganz in ihm existieren, ihn als selbstverständlich erachten. Der Mensch wird sich selbst als Mensch Symbol, trägt den Kosmos samt seinen Göttern in sich selbst hinein wie ein Hamster das Essen in seine Höhle. So kahl das Außen wird, so leuchtend und total wird das Innen. Und dieses Leuchten brauchen wir auch, denn da die Elben nach Valinor zurückgekehrt sind, sind wir nun ganz allein in Mittelerde und ein kalter Wind weht stets durch die verlassenen Ruinen von Bruchtal. (Nur einige alte, misanthropische Ents sollen noch in den Wäldern leben.)
*