1.
So schwer es heute dem wachen Bürger zunehmend fallen mag, keinen Ekel vor der zeitgenössischen Politik zu empfinden, so schwer fällt ihm gleichzeitig das Formulieren von Änderungsvorschlägen. Zu sankrosankt die Säulen des Systems, das für sich das Recht, die Verfassung, Begriffe wie “Vernunft” oder “Demokratie” in Anspruch nimmt, ohne dem damit verbundenen Anspruch in der Realität oftmals gerecht werden zu können. Zu gefährlich das Sägen an Fundamenten, das bei deren Einsturz doch mutmaßlich aufs Neue den “ewigen Deutschen” — den Massenmörder, den autoritären Charakter, den Kriegstreiber — zum Vorschein brächte, will man den einschlägigen (und in der Regel vom Staat direkt oder indirekt bezahlten) Experten Glauben schenken.
Und dennoch gibt es vielleicht ein Moment, wenn der Ekel über die tägliche Politikfarce über das gewohnheitsmäßig Akzeptable, Verdrängbare, Normalisierbare notwendigerweise hinausgehen muss. Wenn eine chronisch unfähige Verteidigungsministerin wie Ursula von der Leyen während eines noch laufenden Amtsmissbrauchsverfahrens als Präsidentin der Europäischen Union installiert wird, mögen Abscheu und galliges Gelächter noch ausreichen. Doch wenn eine reale Gefahr wie das Corona-Virus tatsächlich einmal konkret die Frage nach Leben und Tod von hunderttausenden Menschen aufwirft, wenn das von Politik und Medien veranstaltete Gehampel, die Phrasendrescherei, die fortwährende Widersprüchlichkeit nicht einmal mehr notdürftig die intellektuelle wie charakterliche Überforderung zu verdecken imstande sind, überkommt auch den zynischen Beobachter das Grauen, unser wortwörtliches Leben einer dilettantischen Clownskaste ausgeliefert zu sehen.
Diese Einsicht ist nicht neu, und wird dennoch — im Zuge einer verinnerlichten “Alternativlosigkeit” des Bestehenden — zumeist als Polemik formuliert. Der Wutbürger lässt am Stammtisch (heute oft virtuell) seinen Frust ab, und das erlauben ihm die Mächtigen auch, denn es ermöglicht ihm einen emotionalen Ausgleich, der ihn zumindest so weit beruhigt, um auf ernsthafte Infragestellung oder Opposition zu verzichten. Doch verstellt die Polemik, die in unserer Gesellschaft zunehmend eine ähnliche Routine entwickelt wie der Dilettantismus der Politik, die Perspektive auf substanzielle Kritik. Wo die Kritik am Betrieb selbst zum Betrieb degeneriert, ist das finale Reich des Geredes vollendet.
Wird der Befund allerdings nicht bloß polemisch, sondern als ernsthafte These getroffen, schließen sich ihm eine Reihe hochinteressanter Fragen an: Wieso eigentlich werden wir nicht von Fähigen, sondern von Unfähigen regiert? Was sind die Mechanismen, die im Hintergrund wirken, um diese Auswahl hervorzubringen? Ist das System, das unser Land zur Genese politischer Entscheidungsträger pflegt, vielleicht einfach falsch, undurchdacht, reformbedürftig? Wenn unser aktuelles System dysfunktional ist, worin besteht diese Dysfunktionalität und wie könnte sie überwunden werden?
2.
In dieser grübelnden Stimmung also quarantänisiert auf dem Balkon in der frühlingsmilden Luft sitzend [1] fällt mir bei der Suche nach Lektüre Oswald Spenglers Aufsatz “Vom Neubau des Deutschen Reiches” aus dem Jahr 1924 in die Hände. Die politischen Schriften der als “Konservative Revolution” Summierten sind aus heutiger Sicht nur reflektiert zu genießen, denn ihnen wohnt ein starker Zeitcharakter inne. Erstens sind sie von massiver Frustration über die deutsche Niederlage und die in deren Zuge installierte Weimarer Republik erfüllt, was ihre Wahrnehmung einseitig macht. Zweitens schreiben sie aus der Perspektive der noch während der Kaiserzeit Sozialisierten heraus, und jenseits der Frage, ob diese Affirmation der alten Ordnung denn berechtigt wäre oder nicht, können wir Heutigen feststellen, daß diese Vorkriegsgesellschaft mittlerweile nicht mehr existiert. Bezieht Spengler sich in “Preußentum und Sozialismus” auf den preußischen Militarismus, so beschreibt er dabei eine damals noch lebendige Tradition und Kultur, die tatsächlich auf eine den Staat konstituierende Weise hätte genutzt werden können. (Und 9 Jahre später durch die Nationalsozialisten auch genutzt und “vernutzt” wurde.) Heute sind davon nur noch Erinnerungen übrig, deren Wirklichkeitsgehalt nicht wesentlich höher als der von Mittelerde oder Hogwarts liegen dürfte, ein allzu direkter Bezug, ein unreflektiertes Versenken darin dementsprechend mehr den Charakter romantischen Eskapismus’ denn politischer Kritik trägt.
Dabei ist es gerade die politische Romantik, die Spengler, der als Nietzsche-Schüler stets zwischen Idealen und Tatsachen trennt, zeitlebens bekämpft hat: “Ich gab [in “Preußentum und Sozialismus” und “Neubau des deutschen Reiches”] keine allgemeine, nebelhafte Theorie, kein ideologisches Wunschbild, über das Dilettanten in Verzückung geraten könnten, kein “optimistisches” Programm, durch das Probleme vornehm ignoriert und beiseite geschoben werden, sondern ein Bild der Tatsachen, und weiter nichts. Es war hart, unerbittlich, grausam, aber es kommt nur darauf an, ob es richtig ist oder nicht. Weil es das war, erhob sich das Geschrei über Pessimismus: ich stellte Tatsachen fest, wofür es den anderen an Mut, vielleicht auch an Ehrlichkeit fehlte. Daß sie sehr ernst sind, ist unser Schicksal, nicht meine Art, es zu sehen.” (Vorwort zu den “Politischen Schriften”, 1932)
Spengler zu lesen muss also in diesem Sinn immer auch bedeuten: Spengler zu überwinden, seine Texte nicht als metaphysisches Lehrgebäude, nicht als objektive Wahrheit, deren Ziel lediglich die passive Affirmation sein kann, aufzufassen, sondern als Haltung begreifen zu lernen, um sich der Gegenwart aktiv und illusionslos zu widmen. “Wer auf der Höhe seiner Zeit steht, mußte 1830 Demokrat sein und 1930 das Gegenteil davon, wie er 1730 Absolutist sein musste und 1830 nicht.”, schreibt Spengler, und zeigt damit, daß er selbst im Gegensatz zu vielen seiner Kritiker und auch Anhänger den Zeitcharakter seiner politischen Schriften durchaus reflektierte.
Dessen eingedenk sind auf der anderen Seite die Köpfe der Konservativen Revolution, diese Verteidiger einer alten, mittlerweile untergegangenen Ordnung, bei weitem nicht so beschränkt, wie die heute zum akademischen Gemeingut zählende Polemik ihrer Gegner es gerne glauben machen will. Gerade dadurch, daß ihnen biographisch der Vergleich von Monarchie und Demokratie möglich ist, nehmen sie die Schwächen des Weimarer Modells mit frappanter Schärfe wahr, und treten in den 20ern mit seinen Verteidigern in einen erbitterten Wettstreit der Ideen. Die gesamtkulturell noch weitgehend unvermittelte Neuheit der Demokratie erlaubt ihren Kritikern dabei eine radikale Grundsatzkritik, wie sie heute, sei es aus generationenlanger Gewöhnung oder aus Scheu, nicht mehr gepflegt wird. Damit schießt sie teilweise weit über das Ziel hinaus. Spenglers Annahme, daß die Demokratie weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Großbritannien oder Frankreich, in den letzten Todeskrämpfen läge, wirkt aus heutiger Sicht obskur — im Rückblick ist es stattdessen die Demokratie, die sich im Kampf der Systeme des 20. Jahrhunderts als langfristig lebensfähig und moralisch human erwiesen hat. Doch ebensowenig wie die Sozialisten sich vom Ausbleiben des jahrzehntelang pathetisch prognostizierten, baldigen Untergangs des Kapitalismus entmutigen liessen, stattdessen in der Nachkriegszeit ihre Theorie mit großem Erfolg in demokratischem Kontext erneuerten, so kann vielleicht auch aus konservativer Sicht der Kessel der Weimarer Republik als Ideensteinbruch betrachtet werden, um daraus ein erneuertes, kritisches Bewußtsein auf der Höhe der Zeit zu entwickeln. “Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, mit Ausnahme aller anderen” — das mag in der Tat eine Lehre des 20. Jahrhunderts sein, die Spengler noch verschlossen war. Dennoch trägt dieser Satz auch das Eingeständnis von Schwächen mit sich, deren Reflektion auch der heutigen Gesellschaft gut zu Gesicht steht, da Fehlentwicklungen, Probleme, gesellschaftliche Spannungen sich unübersehbar mehren.
3.
“Der Sumpf” überschreibt Oswald Spengler das erste Kapitel, und bemerkenswert ist, wie aktuell seine Schilderung damaliger Mißstände klingt.
“Während man in der ganzen Welt daran ging […], die marxistische Mode der letzten Kriegsjahre zurückzudrängen, die nichts war als der Versuch, ganze Völker und Staaten zu Objekten der Ausbeutung durch eine einzelne Klasse zu machen, begann die Ausbeutung Deutschlands durch die Gewerkschaft seiner selbsternannten Befreier. Tausende von Posten wurden geschaffen, bis in die Dörfer hinein, Ministerien gegründet, Ausschüsse niedergesetzt. […] Ministerpensionen blühten zu Hunderten in der Maiensonne des republikanischen Deutschland und hinter dem Ministertanz erblickte man die offenen Mäuler und gierigen Augen von tausend Partei- und Gewerkschaftssekretären, Parteijournalisten, Vettern, Geschäftsfreunden, die noch nicht daran gekommen waren. […] Die Ministersitze wurden bei den ewig wechselnden Koalitionen als Beute aufgeteilt, ohne Rücksicht auf Eignung, Arbeitswillen oder Arbeitskraft. Die großen Ämter zerfielen, ohne sachverständige Leitung, sich selbst überlassen, überfüllt, durch Parteikreaturen verseucht.”
Spenglers Feindbild sind dabei die Parteien selbst. Er fasst sie als zielbewußte, organisierte Gemeinschaften auf, denen Wahlen und Wahlerfolge nur strategisch dienen, um die dadurch gewonnene Macht zur Versorgung der eigenen Mitglieder zu nutzen. Sie kapern den Staat, schreiben sich die Gesetze in ihrem Sinne zurecht, und bedienen sich dann egoistisch an den Ressourcen des Landes, während übergeordnete Ziele, das Wohl des Landes an sich, keinerlei Rolle mehr spielen.
“In ihren Satzungen ist nicht von Volk die Rede, sondern von Parteien; nicht von Macht, von Ehre und Größe, sondern von Parteien. Wir haben kein Vaterland mehr, sondern Parteien; keine Rechte, sondern Parteien; kein Ziel, keine Zukunft mehr, sondern Parteien.”
Auf diese Weise betrachtet Spengler also den Parlamentarismus der Weimarer Republik. Das mag in mancher Hinsicht polemisch überzogen sein, aber bringt dennoch einen hässlichen Aspekt zum Vorschein, der damals wie heute die Idealkonstruktionen politischen Geschehens durchwuchert: den des konkreten, persönlichen Vorteils.
Doch wie lässt sich die Genese solcher Korrumpierung beschreiben? Wie werden Parteien, Politiker, Parlamente das, was sie sind? Es ist interessanterweise gerade kein dezidiert rechter Ansatz, der hier bei der Beschreibung des Parteienverhaltens weiterhilft, sondern die Public Choice Theorie des liberalen Theoretikers und Nobelpreisträgers James Buchanan. Ausgehend von der Prämisse, daß Menschen Entscheidungen im Sinne je-eigener, individueller Nutzensmaximierung treffen, kommt er zu dem ernüchternden Ergebnis, daß das Handeln demokratischer Politiker nicht notwendigerweise an richtigen oder sinnvollen Entscheidungen ausgerichtet sein muss, sondern — an ihrer Wiederwahl.
In der Konsequenz von Buchanans Theorie, gesellschaftliches Handeln und damit auch Wahlen als Tauschbeziehung aufzufassen, führt das zu einer populistischen Klientelpolitik, bei der der Staat fortwährend Geschenke und Zuwendungen verteilen muss, um sich dabei zum Schaden des Gemeinwesens immer weiter aufzublähen. [2]
An diesem vorhersehbar staatskritischen und relativ biederen Punkt enden Buchanans Überlegungen leider bereits wieder. Doch nehmen wir seinen Ansatz und kombinieren ihn mit Spenglers Parteienkritik, stoßen wir im Sinne der Public Choice Theorie auf eine zweite, wirksame Beziehung, die bis heute weitgehend unreflektiert geblieben ist: die zwischen Politiker und Partei.
4.
Versetzen wir uns also in einen ambitionierten Jungpolitiker hinein. Er mag durchaus aus idealistischen Gründen in die Partei seiner Wahl eingetreten sein, motiviert vom Wunsch, sein Land zum Besseren zu verändern. Die Parteien freuen sich immer über neue Mitglieder, er wird sicherlich willkommen geheißen, findet vor Ort eine Gruppe von weltanschaulich Gleichgesinnten, und sofern er auch entsprechende Fähigkeiten, sei es organisatorischer, rednerischer oder politischer Natur, erkennen lässt, wird er sicherlich zunächst einmal auch freundliche Förderung erfahren.
Doch an dem Punkt, an dem er nicht nur die Plakate anderer aufhängen will, sondern selbst nach oben strebt, sei es als Wahlkreiskandidat oder regionaler Vorsitzender, kippt die wohlige Parteienharmonie in ein außerordentlich hartes Konkurrenz- und Wettbewerbsverhältnis, denn natürlich sind die entsprechenden Posten bereits besetzt, und werden in der Regel nicht freiwillig geräumt. Da aber die Parteien auch intern demokratischen Prinzipien folgen, werden die begehrten Posten regelmässig innerparteilich zur Wahl gestellt. Im idealdemokratischen Sinne nun stellt unser Jungpolitiker sich einfach wacker zur Wahl, und überzeugt mit einer leidenschaftlichen Rede, mit Inhalt, Ausstrahlung und Beherztheit seine Parteigenossen, die nun unwillkürlich mitgerissen begeistert applaudierend aufspringen, während der intrigante Amtsinhaber mit versteinertem Gesicht am Rand sitzt. Ja, wir alle kennen die Filme.
Nur: so läuft es natürlich nicht. “Freund, Feind, Parteifreund” — Parteien sind traditionell abgründige, darwinistische Haifischbecken, bestehend aus einer Unzahl verschiedenster Grüppchen, die regional, ideologisch oder durch charismatische Einzelcharaktere geprägt sein können; aus Netzwerken, Verbindungen, aus Sympathie und Antipathie und im Kreis der ambitionierten Alphatiere aus rücksichtslosem Ehrgeiz, eigenen Karriereambitionen und hochgradig strategischem Kalkül. Unser Jungpolitiker wird letztlich auf ebenso mühsame Weise wie seine Konkurrenten und Vorgänger versuchen müssen, bereits vor der Wahl Unterstützer, Förderer, innerparteilich einflußreiche Gruppen und Netzwerke aufzuspüren und für sich zu gewinnen, um sich das aufzubauen, was gemeinhin “Hausmacht” genannt wird. Einen quantitativ maßgeblichen Unterstützerkreis also, der ihm in den entscheidenden internen Kampfabstimmungen die Mehrheit verschafft, und auch langfristig, wenn also nach dem Ende einer Wahlperiode erneute Abstimmungen anstehen, und vielleicht schon das nächste, junge Talent nach vorne drängt, treu hinter ihm steht.
“Er will Kreisvorsitzender werden, zieht Strippen, geht durch Stahlbäder – anders kann man die kommunalpolitischen Gemetzel in der Tiefe des Münsterlandes, wie Bröcker sie schildert, nicht bezeichnen. Es gelingt Spahn, überall Getreue zu platzieren, die ihm bis heute helfen. 2002 zieht er mit 48,2 Prozent als jüngster direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein.” — so heißt es beispielsweise in einer Rezension zu Jens Spahns Biographie, und so liest man es häufig. Das Fundament einer Politikerkarriere bilden keine Hollywood-Momente, sondern anstrengende und moralisch oft durchaus grenzwertige Netzwerkarbeit.
Für James Buchanan steht der Parlamentsabgeordnete in einem direkten Abhängigkeits- und Nutzensverhältnis zum Wähler, zu dessen Interessen und Wünschen, wodurch die Gefahr besteht, den oft kurzsichtigen, egoistischen Wünschen des Wählers die eigentlich vernünftigen Entscheidungen zu opfern. Nun aber wird sichtbar, daß ein vergleichbares Verhältnis auch im innerparteilichen Rahmen besteht. Denn wie gewinnt der aufstrebende Politiker all diese internen Grüppchen, die oft miteinander in einem rivalisierenden Verhältnis stehen, wie überzeugt er die Basis, wie umgarnt er die Führungsfiguren, damit sie ihn nicht als Bedrohung der eigenen Ambitionen wahrnehmen? Wie hält er diesen Unterstützerkreis über Jahre, vielleicht Jahrzehnte in stabiler Treue zu ihm, um die stets vorhandenen Herausforderer auf seinen attraktiven Posten abzuwehren? Er muss ihnen allen etwas bieten.
Das kann durchaus auch bloß Charisma, Aufmerksamkeit, Teilhabe, oder ehrliche Interessensrepräsentation sein. Wir wollen nicht zynisch werden. Und doch liegt die Vermutung nahe, daß aufgrund der demokratischen Organisation der Parteien auch hier in der Praxis gerne der korrumpierte, verantwortungslose Weg beschritten wird, wie ihn die Public Choice Theorie beschreibt. Das bedeutet, daß die Parteieliten in einem vergleichbaren Nutzens- und Abhängigkeitsverhältnis zu den restlichen Parteimitgliedern stehen wie der Politiker zum Wähler, und deshalb im Sinne der eigenen Nutzensmaximierung Entscheidungen treffen, die primär vom eigenen, innerparteilichen Machterhalt motiviert sind. Daß Ministerposten nicht nach Kompetenz, sondern nach innerparteilichem Rückhalt, innerparteilichen Machtverhältnissen strategisch verteilt werden, daß eigentlich bereits als falsch reflektierte Entscheidungen dennoch getroffen werden, weil die Mehrheitsverhältnisse in der Partei ungünstig sind. Daß nicht zuletzt auch Versorgungsstrukturen entstehen, um mittels gutdotierter Posten in Stiftungen, Vereinen, Gewerkschaften, Medien, angeschlossenen Unternehmen die Treue der eigenen Anhängerschaft zu sichern.
Außerdem erzeugt der Wahlmodus in seiner darwinistischen Selektionsdynamik strukturbedingt ununterbrochen Ausgesonderte. In der öffentlichen Wahl unterlegene Spitzenkandidaten, die fallengelassen werden, Opfer politischer Skandale, deren öffentlicher Leumund zerstört ist, oder auch verdiente, langjährige Spitzenpolitiker, die irgendwann doch in einer Kampfabstimmung dem aufstrebenden Jungspund unterliegen — in allen diesen Fällen verfügen die Ausgesonderten über einen beträchtlichen Rückhalt in der Partei, weshalb es notwendig wird, ihnen möglichst gesichtswahrende Abstellgleise zu schaffen, damit keine Unruhen der düpierten Anhänger, sogenannte “Palastrevolten” entstehen. [3]
Kurzum: in der Übertragung der Public Choice Theorie auf innerparteiliche Vorgänge wird genau die Eigendynamik sichtbar, die Spengler in “Neubau des Deutschen Reiches” zornig beschreibt, und die wir auch heute im politischen Alltag fortwährend als von außen absurd und widerwärtig wirkendes Schauspiel erleben.
5.
Jedoch ist Spenglers Text nicht bloß Abrechnung, sondern der Versuch, der falschen politischen Struktur eine richtige gegenüberzustellen. Dabei interessieren ihn weder die heiligen Kälber demokratischer Prinzipien noch abstrakte Rechte, es zählen alleine die Ergebnisse: “ ‘Rechte des Volkes’ sind lächerlich, solange man darunter die Freiheit versteht, sich von Parteien verderben zu lassen. Es gibt nur ein Volksrecht: das auf die Leistungen derer, welche regieren. Wenn in der großen Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert die ‘Fürstenfreiheit’ durch Völkerfreiheit ersetzt werden sollte, so konnte ein Sinn nur darin liegen, wenn die Auslese der Regierenden besser, deren Methoden erfolgreicher, ihre Leistungen größer wurden.”
“Ein Volk hat nur ein Recht: gut regiert zu werden, und da es als Masse ohne Erfahrung und Überblick das nicht selbst übernehmen kann, so müssen es Einzelne tun und diese müssen richtig ausgesucht und angesetzt werden. Das ist das ganze Geheimnis aller gut regierten Staaten und alle mit Überlegung ausgearbeiteten Verfassungen können nur sichern — oder verhindern -, was in primitiven Zeiten mit rascher Anwendung von Gewalt ganz von selbst geschieht.”
Theoretisch ausgedrückt ist Spengler Anhänger des “positiven Rechts”: dem Menschen kommen keine “unveräußerlichen” oder “natürlichen” Rechte zu, er besitzt lediglich Anspruch auf das, was er aus eigenen Fähigkeiten heraus zu erschaffen vermag. Und da ein Volk sich nicht unvermittelt, also ohne organisatorische Struktur regieren kann, ist das, was man als “Kultur”, als “Politik” oder auch “Lebensqualität” bezeichnen könnte, primär ein Resultat der eigenen Fähigkeit zur Selbstorganisation, zur Auslese und Ausbildung einer fähigen Führungsschicht.
Demokratie hat keinen Wert an sich, sagt Spengler. Diese Regierungsmethode macht nur dann Sinn, wenn die daraus resultierende Politik der Leistung anderer Systeme überlegen ist. Doch wie gesehen weist Demokratie systemische Schwächen auf: erstens ergeben sich aus der Beziehung demokratischer Wahlen korrumpierende Abhängigkeitsverhältnisse, sowohl im Verhältnis von Wähler zu Politiker, als auch parteiintern. Zweitens, und darauf wird später noch gesondert einzugehen sein, ist auch fraglich, ob die innerparteiliche Organisation unserer Parteien tatsächlich die fähigsten Leute in Führungspositionen bringt, bzw. umgekehrt ausgedrückt: womöglich sind die Fähigkeiten, die für den innerparteilichen Aufstieg benötigt werden, nicht unbedingt deckungsgleich mit den Fähigkeiten, die es für verantwortungsvolles, kluges Regieren braucht.
Es sind letztlich drei zentrale Aspekte, um die Spenglers Denken kreist, um in Überwindung eines korrumpierenden Parteiendenkens den Neubau des Deutschen Reiches zu leisten:
a) Gemeinwohlorientierung
b) Erziehung und Auswahl
c) Leistung und Rechenschaft
Wir werden sie in den folgenden Teilen behandeln. Es lebe das Heilige Deutschland.
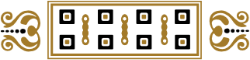
Fußnoten:
Darüberhinaus kann Buchanans Ansatz noch weitere interessante Fragestellungen sichtbar machen, die ich allerdings hier in die Fußnoten auslagere, um die argumentative Stringenz des Textes zu erhalten.
1: In Buchanans Modell finden wir eine völlig transparente 1:1‑Situation vor: der Politiker agiert, der Wähler wertet entsprechend. Doch was wäre, wenn die Politik die ihr vom Souverän verliehene Macht nutzen würde, um den Informationsfluß zu manipulieren? Diese Methode wurde bereits in der Ära Schröder bei den Arbeitslosenstatistiken üblich, die damals, als Deutschland als “kranker Mann Europas” galt, jeden Monat, von bangen Blicken begleitet über die Bildschirme flimmerten. Ist der Arbeitslose über 58, macht er gerade eine Weiterbildung, wurde er zu einer Maßnahme verdonnert, oder ist er krank — in allen Fällen wird er aus der Statistik gestrichen, obwohl er de facto arbeitslos ist und Sozialleistungen bezieht. Gestrichen wird auch, wer aufgrund fehlender Sprachkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt unvermittelbar ist — dies wurde nach 2015 bei hunderttausenden Flüchtlingen so praktiziert, um den massiven Anstieg von asylbedingter Arbeitslosigkeit unsichtbar zu machen.
2: Und ein weiteres Fragezeichen im Verhältnis von Politik und Wähler: was wäre, wenn nicht die Politik selbst manipuliert, sondern die Presse ein Eigeninteresse entwickelt? Die Presse als entscheidender Vermittler, als ausschließliches Diskursmedium moderner Massendemokratien taucht im Formalismus der Public Choice Theorie überhaupt nicht auf, obwohl in der Realität das individuelle Entscheidungsverfahren selbstredend von der zur Verfügung stehenden Information abhängt. Traditionellerweise spricht man freien Medien ein regierungskritisches, aufklärerisches, oppositionelles Interesse zu, man könnte spieltheoretisch überdies davon ausgehen, daß sie auch ein kommerzielles Interesse an der Aufdeckung von Skandalen und Problemen haben müssten. Doch was wäre, wenn sie die Seiten wechseln würden?
Von Buchanan ausgehend ist nämlich auch eine gedrehte Konstellation möglich: wenn die Politik “richtige” Entscheidungen zu treffen wünscht, die allerdings aufgrund dem kurzsichtigen Egoismus der Wähler auf Ablehnung stoßen. In diesem Fall kann sich ein Eliten-Bündnis aus Politik und Medien bilden, um durch das Vorenthalten oder Verzerren von Informationen eine aus Sicht der Eliten irrationale, egoistische oder kurzsichtige Reaktion des Wählers zu vermeiden.
Witzigerweise befindet diese eigenartige Konstellation sich mittlerweile außerordentlich nahe an der Realität westlicher Gesellschaften. Auch die im Sinne des Markt-Szenarios erwartbare Reaktion, daß nämlich die Verkaufszahlen der dergestalt ihre vormalige Rolle aufgebenden Medien massiv einbrechen, weil ein Interessens-Bruch zwischen Presse und Leser entsteht, ist beobachtbar. Der Markt korrigiert indes nichts, vielmehr bewerben die klammen Medienhäuser sich zunehmend um staatliche Unterstützung, die ihnen aufgrund ihres aus Sicht des Staates vorbildlichen Engagements auch gerne gewährt wird. (Wobei dieses Szenario mittels Buchanans Public Choice Theorie durchaus modelliert werden könnte, da er im Gegensatz zu manch anderen liberalen Theoretikern ethische oder altruistische Motive durchaus auch als subjektiv gesuchten “Nutzen” anzuerkennen imstande ist. Dennoch müssten dafür die Journalisten als eigenständige Akteure eingeführt werden. Faszinierende Angelegenheit, aber leider weit entfernt von unserem Thema.)
Der Ehrgeiz richtet sich dementsprechend auf die innerparteilichen Auswahlmodi, es sind die attraktiven Wahlkreise, in denen seit Jahrzehnten klare Mehrheiten erzielt werden, es sind die vorderen Listenplätze, die im Rahmen vorab meist recht genau prognostizierter Wahlausgänge den Einzug ins Parlament versprechen. Die eigentliche Arbeit des aufstrebenden Politikers findet innerhalb der Partei statt, hier wird die Karriere in die Wege geleitet, gegen Konkurrenten agitiert, hier manifestieren sich langjährige, persönliche Vertrauens- und Solidaritätsverhältnisse, hier muss eine dezidierte, politische Position ausgearbeitet und verteidigt werden.
Der konkrete Wähler vor Ort dagegen verlangt vom durchschnittlichen Abgeordneten nicht viel, dem Politiker reicht in der Regel neben konsensfähigem Abspulen aktueller Kernpositionen die Fähigkeit, auch nach dem hundertsten “Also in echt sehen Sie ja ganz anders aus!” Ausruf irgendeiner exaltierten Hausfrau beim Besuch des zwanzigsten Dorfkindergartens nicht gelangweilt und überheblich, sondern stets aufmerksam, freundlich und bescheiden aufzutreten, ins Blaue hinein vage Unterstützung zuzusichern, und mittels einer Handvoll routinierter Scherze gelegentlich sogenannte “Volksnähe” zu demonstrieren. Eine dezidiertere Erwartungshaltung an Politiker ist in unserer Gesellschaft nicht üblich.
