1.
Womöglich gibt es wenig, was für den deutschen Konservatismus so konstitutiv ist wie das Ethos eines partei- und interesseübergreifenden Gemeinwohls. Bereits Bismarck schreibt angesichts der Tumulte von 1848: “Ich glaube, die Gesinnung der großen Mehrzahl der Ritterschaft dahin aussprechen zu können, daß in einer Zeit, wo es sich um das soziale und politische Fortbestehen Preußens handelt, wo Deutschland von Spaltungen in mehr als einer Richtung bedroht ist, wir weder Zeit noch Neigung haben, unsere Kräfte an reaktionäre Versuche oder an Verteidigung der unbedeutenden und uns bisher verbliebenen gutherrlichen Rechte zu vergeuden, sondern gerne bereit sind, diese auf Würdigere zu übertragen, indem wir dieses als untergeordnete Frage, die Herstellung rechtlicher Ordnung in Deutschland, die Erhaltung der Ehre und Unverletzlichkeit unseres Vaterlandes aber als die für jetzt alleinige Aufgabe eines jeden betrachten, dessen Blick auf unsre politische Lage nicht durch Parteiansichten getrübt ist.” (Bismarck, Gedanken und Erinnerungen)
70 Jahre später ist es gerade der Verlust einer überparteilichen, auf das Wohl des Volkes gerichteten Perspektive, die Oswald Spenglers Wut entfacht: “In ihren Satzungen ist nicht von Volk die Rede, sondern von Parteien; nicht von Macht, von Ehre und Größe, sondern von Parteien. Wir haben kein Vaterland mehr, sondern Parteien; keine Rechte, sondern Parteien; kein Ziel, keine Zukunft mehr, sondern Parteien. […] Sie waren entschlossen, jeden Grundsatz, jede Idee, jeden Paragraphen der eben beschworenen Verfassung für ein Linsengericht preiszugeben. Sie hatten diese Verfassung für sich und ihre Gefolgschaft gemacht, nicht für die Nation, und sie begannen vom Waffenstillstand bis zur Ruhrkapitulation eine schmachvolle Wirtschaft mit allem, woraus Vorteil zu ziehen war, mit den Trümmern des Staates, mit den Resten unseres Wohlstandes, mit unserer Ehre, unserer Seele, unserer Willenskraft.” (in: Neubau des Deutschen Reiches)
Und noch einmal 100 Jahre später findet sich die Wahrnehmung, der Staat wäre zur Beute der Parteien geworden, nahezu unverändert bei der Rechten wieder, hier beispielsweise im Podcast “Die Krisentrinker #1”, einem Gespräch zwischen Götz Kubitschek und Erik Lehnert.
“[Götz Kubitschek:] …und: Finger weg von erbeuteten Institutionen. Die Institutionen befreien, damit sie nicht die Beute der Parteien bleiben, sondern in ihre gesamtstaatliche Würde zurückgeholt werden. […]
[Erik Lehnert:] Wir müssen den Institutionen die Würde zurückgeben, wir müssen dem Staat die Würde zurückgeben, und im Grunde ist die ganze Beutegemeinschaft gegen uns. Und die Beutegemeinschaft sagt eben auch zu den Neuen: ‘Kommt doch zu uns, seid Mit-Beutegemeinschaft.’
Was soll ich sagen… Aus meiner Sicht ist es legitim, darüber zu sprechen, wie wäre es möglich, diesen ganzen Missbrauch der Institutionen zu beenden? Aber wir wissen beide: wenn wir das tun, wird der Onkel Haldenwang kommen und sagen: ‘Ah, das ist nicht freiheitlich-demokratische Grundordnung, weil die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist der Parteienstaat.’ ”
Die Kontinuität konservativen/rechten Denkens über einen Zeitraum von fast 200 Jahren ist bemerkenswert, bezeichnend ist aber auch die Veränderung der gesellschaftlichen Position.
Bismarcks Haltung ist offenkundig noch feudalistisch geprägt, aus einem ritterlich-aristokratischen Pflichtbegriff heraus, dem das Zurückstellen eigener Interessen bis hin zum persönlichen Opfer im Dienst für das Vaterland, bzw. den es repräsentierenden Monarchen, anerzogen wurde. Als “Preußentum”, als von soldatischem Pflicht- und Ehrgefühl geleitetes Ethos wurde es zum politischen wie gesamtgesellschaftlichen Stil des neugegründeten “Zweiten Reichs”. [1]
Aus Spengler spricht 75 Jahre später bereits der Verlust. Sozialisiert noch in der Wilhelminischen Epoche, findet er, der sogar sein Hauptwerk mit “Ich habe nur den Wunsch beizufügen, daß dies Buch neben den militärischen Leistungen Deutschlands nicht ganz unwürdig dastehen möge.” einleitete, um die vaterländische Verbundenheit seines Wirkens auszudrücken, sich nach dem Weltkrieg plötzlich in einer verzweifelten, machtlosen Oppositionsrolle wieder. Heutige Historiker neigen dazu, die Anti-Weimarianer der Konservativen Revolution als lediglich negativ-destruktive Elemente aufzufassen. Mir dagegen will es manchmal scheinen, als glichen sie eher unglücklich Verliebten, betrogenen Liebhabern, die plötzlich eines Abends in einer Seitengasse die Angebetete im Arm eines Fremden erblicken. Es ist mehr Herzenserschütterung als politische Opposition. Und so stochern sie nun, hineingestoßen in einen Alptraum, der ihnen alles genommen hat, woran sie politisch und kulturell geglaubt haben, in der Asche Weimars nach den Überresten einer zusammengebrochenen Epoche, um sie irgendwie zu rekonstruieren.
2.
Eine gute Wendung nimmt die Geschichte allerdings nicht. Denn in der Gegenwart, wie im Gespräch zwischen Erik Lehnert und Götz Kubitschek sichtbar wird, wird der Wunsch nach einer parteientranszendierenden Politik mittlerweile als hochproblematisch, gar potentiell verfassungsfeindlich wahrgenommen.
Nicht grundlos: der rosa Elefant im Raum zwischen 1924 und 2020 heißt natürlich Nationalsozialismus. Es war der Nationalsozialismus, der die reaktionären Strömungen der Weimarer Zeit bündeln und in ein destruktives Geschoß verwandeln sollte, um mit einem der barbarischsten Blutbäder aller Zeiten in die Geschichte der Menschheit einzugehen. Und wie die Linke dazu neigt, die Massaker und das wirtschaftliche Versagen des “real existierenden” Sozialismus auszublenden, so hat die Rechte es bislang versäumt, eine eigene, kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu leisten. Man pendelt stattdessen seit 70 Jahren zwischen phrasenhafter Distanzierung, verschämter Koketterie, Abwiegeln und Relativieren, zwischen reinem Ausblenden, strategischen Begriffsumbildungen und resigniertem Rückzug in die eigene Subkultur. Es ist ein trauriger Anblick. Die Aufarbeitung wird stattdessen vom politischen Gegner geleistet und in das jeweilige Theoriegerüst gehüllt: aus liberal-kapitalistischer Perspektive sammeln sich auf der Rechten einfach die Verlierer, die vom “Fortschritt überfordert” sind, aus marxistischer Perspektive ist rechtes/nationalistisches/traditionalistisches Denken nur “Opium fürs Volk”, nur Ablenkungsmanöver des kapitalistischen Apparates, um das Proletariat weiterhin in einem Ausbeutungsverhältnis zu halten. In dieser Perspektive können rechte Ideen immer nur als Fehler im System, als groteske Auswüchse, als eine Mischung aus Dummheit, Wahnsinn und dem menschgewordenen Bösen erscheinen, und natürlich ist der Nationalsozialismus geeignet, diese Vorstellung anschaulich zu illustrieren.
Wenn also rechtes Denken sich in der Gegenwart nicht zu intellektueller Belanglosigkeit verdammen, nicht als längst überwundener, gefährlicher Blödsinn abgetan werden will, so muss es sich, statt “Schuldkult!”-schreiend in die Höhle solipsistischer Ideologie-Selbstreproduktion zurückzuflüchten, dem kritischen Diskurs stellen. Worin bestehen nun die Vorwürfe derjenigen, die für sich in Anspruch nehmen, aus der Geschichte gelernt zu haben? Gerade im Kontext des Rechtspopulismus ist die Auseinandersetzung in den letzten Jahren wieder virulent geworden.
“Populisten sprechen in ihren Reden und Medienbeiträgen “das Volk”, “die einfachen Leute” oder – häufig ganz selbstverständlich auf die männliche Version beschränkt – “den kleinen Mann auf der Straße” an. Dabei wird suggeriert, dass “das Volk” eine Einheit sei. Interessengegensätze, die es in modernen Gesellschaften in vielfacher Weise gibt, werden so implizit geleugnet.” (Bundeszentrale für politische Bildung)
„Populismus zeichnet sich aus durch eine radikale Kritik an den herrschenden gesellschaftlichen und politischen Eliten, denen man vorwirft, dass sie den wahren, eigentlichen Volkswillen nicht vertreten, ja, sogar systematisch hintergehen. Während Populisten von sich selber behaupten, dass sie diesen Volkswillen kennen. Insoweit ist der Populismus vielleicht nicht per se antidemokratisch, aber er steht doch mit bestimmten Prinzipien auch der Demokratie auf Kriegsfuß.“ (Prof. Frank Decker vom Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn im Deutschlandfunk)
“Zum Selbstverständnis von Populisten gehört es auch, dass sie die einzigen Vertreter des „wahren Volkes“ sein wollen. Allen anderen Parteien sprechen sie ab, die Interessen der Bürger vertreten zu können. Diese Auffassung ist zutiefst antipluralistisch und widerspricht unserer demokratischen Grundordnung, in der die Existenz und Konkurrenz verschiedener Interessen Leitgedanke der Legitimität ist.” (Johannes Hillje, Politikberater)
Die Übergänge in der Auseinandersetzung des zeitgenössischen Rechtspopulismus zu Faschismus- und Rechtsextremismustheorien sind dabei für die Verteidiger der bestehenden Ordnung fließend. Im Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung werden für Populismus die wesentlichen Merkmale “Volk”, “Identität”, “charismatische Führerschaft” und “Bewegungscharakter statt Partei” genannt — das ist ein Kernschema vieler Faschismusdefinitionen. Im diesem Sinn werden die Parolen des Rechtspopulismus meist nicht als demokratieinhärentes Protestphänomen, sondern als verklausulierter faschoider Angriff gegen die Demokratie gelesen, und seine Akteure entsprechend harsch bekämpft.
Im Zentrum des Sturms trotzt das Gut Schnellroda, doch wie gesehen stehen die dortigen Akteure trotz ihres Eigenanspruches als intellektuelles Zentrum der Neuen Rechten den Vorwürfen eher überfordert gegenüber. Denn wenn Erik Lehnert einen “Missbrauch der Institutionen” beklagt, stellt sich umgehend die Frage, nach welchen Parametern er diesen Missbrauch überhaupt messen will, was also der richtige Gebrauch sei. Da er diesen nicht nennt, bleibt die Vermutung, daß er lediglich seine eigenen, subjektiven politischen Vorstellungen absolut zu setzen wünscht. Spricht er dann noch von einem “Missbrauch durch Parteien”, und Kubitschek von den Institutionen als “Beute der Parteien”, folgt daraus die Frage, ob denn die AfD, die sie beide unterstützen, keine Partei sei. Ist sie eine Partei, setzt der systemische “Missbrauch” sich nur unter anderem ideologischem Vorzeichen fort. Ist sie dagegen keine Partei, oder soll sie nur als Instrument dienen, um nach einem Wahlsieg das gesamte Parteiensystem zu beenden, wird sie zurecht vom Verfassungsschutz verfolgt.
3.
Wie der Hund, der seinem eigenen Schwanz nachjagt, dreht die Debatte sich hier im Kreis, weil der entscheidende Gedankenschritt fehlt. Deshalb will ich im folgenden aufzeigen, wie das Gemeinwohl sich als überparteilicher Begriff definieren lässt und für eine Demokratie sogar konstitutiv notwendig ist.
“Dem deutschen Volke” ist über dem Portal des Reichstags eingemeisselt, und der Amtseid, den jeder Minister bei seiner Ernennung feierlich ablegt, lautet: “Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden werde.” Den Nutzen des deutschen Volkes mehren und Schaden von ihm abwenden — das klingt in seiner Selbstverständlichkeit profan, öffnet aber auf ganz entscheidende Weise eine Diskursebene, die den bloßen Meinungspluralismus transzendiert. Im Parlament wird nicht bloß geredet, seine Arbeit hat einen Zweck. Den Nutzen des deutschen Volkes mehren und Schaden von ihm abwenden — so kann sinnvollerweise der Begriff des “Gemeinwohls” definiert werden. Und wo im Rahmen unserer Verfassung das Volk den im Parlament repräsentierten Souverän darstellt, so kann der Ausdruck “Wohl des Volkes” als deckungsgleich mit der Definition des Gemeinwohls bezeichnet werden: das Volkswohl ist das spezifische Gemeinwohl aller Deutschen. [2]
Sofern wir also das “Wohl des Volkes” durchaus definieren und konkretisieren können — was überraschenderweise nicht schwer fällt, es reicht bereits der Wortlaut des Amtseides -, fällt die Argumentation zeitgenössischer Politikwissenschaftler und selbsternannter Rechtsextremismusexperten bereits auseinander. Das “Wohl des Volkes” existiert, es ist ein absolut legitimer Begriff. Es muss im Gegenteil gefragt werden, wie gerade eine Demokratie ohne Volkswohl auskommen soll. Denn wie Kant, der bei seiner Kritik am Skeptizismus Humes (der in dieser Hinsicht dem Relativismus zeitgenössischer Pluralitäts-Argumentationen gleicht) letztlich doch auf eine Reihe von “apriorischen” Phänomenen wie die Vorstellung des Raumes und der Zeit stößt, ohne die ein Denken gar nicht möglich ist — kann nicht auf analoge Weise der Parteien-Pluralismus durch ein Apriori des Volkswohls überhaupt erst begründet und legitimiert werden?
Unser politisches System, unsere Institutionen, unsere politischen Entscheidungen — sie können nur unter der Prämisse als sinnvoll betrachtet werden, daß sie den Nutzen des Volkes mehren, und Schaden von ihm abwenden. Ein Handeln oder ein System, von dem objektiv gesagt werden müsste, daß es den Schaden mehrt und den Nutzen abwendet, würde sich selbst die Existenzberechtigung entziehen. Auch einzelne politische Positionen — sei es Ökologie, sei es Sozialismus, sei es wirtschaftliche Deregulierung, Remigration oder Gendersprache: sie alle tragen trotz ihrer Verschiedenheit, ihrer gegenseitigen Widersprüchlichkeit den impliziten Anspruch in sich, eine Verbesserung bewirken zu können, ansonsten wären sie als politische Position nicht kommunzierbar. Damit ist das Volkswohl aber gerade kein demokratiefeindlicher Antipluralismus, sondern die Bedingung der Möglichkeit demokratischer Politik schlechthin.
Auch der Begriff “Wille des Volkes”, dem von zeitgenössischen Politikwissenschaftlern eine antidemokratische Tendenz unterstellt wird, kann so wieder eine berechtigte Stellung erhalten: der Volkswille, der sich über welche Konstitution auch immer institutionalisiert ausdrückt, besteht in der Mehrung des Volkswohles. Nur wenn der Politiker tatsächlich seinem Amtseid gerecht wird, den Nutzen des Volkes mehrt und Schaden von ihm abwendet und damit dem Volkswohl dient, drückt sich in ihm der Volkswille aus. [3]
Allerdings, und hier endet die Analogie zu Kant bedauerlicherweise: während ein Gegenstand nur unter apriorischer Voraussetzung des Raumes gedacht werden kann, so liegt bekanntlich ein Gemeinwesen ohne apriorisches Gemeinwohl durchaus im Rahmen des Möglichen. Sei es eine Despotie, bei der das Land vor den Launen eines übermächtigen Herrschers zittert, sei es eine Klassenherrschaft, bei der eine gesellschaftliche Gruppe eine andere quält oder sei es der parasitäre Parteien-Tribalismus im Rahmen einer Demokratie, den Spengler beschreibt — existieren können solche Zustände durchaus, nur zur Mehrung des Volkswohles können sie sich nicht legitimieren. Stattdessen profitieren nur einzelne Gruppen auf Kosten anderer. Eine Despotie oder eine Diktatur des Proletariats hat indes die Legitimation gegenüber dem eigenen Volk nicht unbedingt nötig — falls die Argumente versagen, kann sie auch durch Gewalt und Einschüchterung herrschen. Eine Demokratie dagegen bedarf als prinzipiell freiwilliger Zusammenschluß einer überzeugenden Begründung. Gerade weil sie im Gegensatz zu autoritären Systemen keine spezifische Herrschaftsschicht kennt, deren Angehörigen ein überlegenes und damit der Kritik enthobenes Beurteilungsvermögen zugesprochen würde, die Möglichkeit der Fehlbarkeit, der Unfähigkeit, der Überforderung damit immer aktuell bleibt, muss der Anspruch, daß die Politik dem Wohl des Volkes dient, und damit den Volkswillen tatsächlich repräsentiert, fortwährend an die Regierenden gerichtet werden können. Darin besteht nicht das Ende der Demokratie, es ist ihr Kern.
4.
Die deutsche Politik ist dem deutschen Volk verpflichtet, so steht es über dem Portal des Reichtstages, so steht es in der Verfassung, so versichern die Minister es während ihres Amtseides. Wenn also Demonstranten “Wir sind das Volk” gegenüber ihren gewählten Repräsentanten skandieren, steckt dahinter nicht notwendigerweise antipluralistische Demokratiefeindlichkeit, sondern die ganz grundlegende Frage nach der Legitimation aktueller Politik. Auch ein Begriff wie “Volksverräter”, so grob er auch sein mag, artikuliert im Kern nichts als den Anspruch, der jedem deutschen Politiker als Maßstab auferlegt ist: daß sein Handeln als legitimer Repräsentant des Volkswillens dem Volk nutzen und Schaden vom ihm abwenden solle.
Daß nun diese Form polemischer Grundsatzkritik, so unreflektiert und aggressiv sie zumeist auch geäußert wird, seit 2015 in Deutschland inflationär Verbreitung gefunden hat, dürfte indes kein Zufall sein. Mit der sogenannten “Grenzöffnung” im September 2015 traf die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Entscheidung mit enormer Tragweite. “Es gibt keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung”, merkte der Philosoph Peter Sloterdijk diesbezüglich im Frühjahr 2016 an — trotz aller PR-Kampagnen der Politik, um dem Bürger die gesellschaftliche “Bereicherung” via Einwanderung zu erklären, ist es nüchtern betrachtet die Frage nach dem Gemeinwohl, die hier zur Disposition steht und zur Eröffnung von Grundsatzdebatten zwingt.
Übersehen wird dabei, daß der Herbst 2015 nur ein Oberflächenphänomen darstellt. Was dahinter steht, ist eine Ideologie, die als eigenwillige Ausprägung eines kapitalistisch domestizierten Wohlstands-Sozialismus in den letzten Jahrzehnten die kulturelle Hegemonie der westlichen Kultur erlangt hat. “Proletarier aller Länder, vereinigt euch” — bereits für den klassischen Marxismus sind Ländergrenzen nur irrelevante Herrschaftsbereiche, gewaltsam zusammengeraubt von einer feudalistischen Oberschicht. Maßgeblich sind für ihn die ökonomischen Verhältnisse, die Klassenzugehörigkeit entweder zu den Besitzenden oder den Besitzlosen. Die Solidarität des deutschen Sozialisten gilt weniger dem deutschen Bürger als dem französischen Arbeiter, da er mit ihm eine gemeinsame Klassenperspektive zu teilen glaubt. Das Volk oder die Nation dagegen sind für ihn Ablenkungsmanöver der herrschenden Klasse: sie schüren ein falsches Solidaritätsgefühl — mit den Kapitalisten des eigenen Landes -, sie erzeugen einen falschen Feind — Fremde -, um von der Ausbeutungsrealität kapitalistischer Strukturen abzulenken. Auch wenn der historische Sozialismus durchaus ein pragmatisches “Selbstbestimmungsrecht der Völker” anerkennt, steht sein Denken damit immer in einem latenten Konflikt mit Nationalstaatlichkeit.
Auf dem Boden der neoliberal induzierten Wirtschafts-Globalisierung entsteht dann seit den 70ern und 80ern ein eigenwilliger Neo-Sozialismus, der die theoretisch “internationalistische” Haltung des klassischen Marxismus zu einer globalen Menschheits-Perspektive weitet. Die Klassentheorie, vormals zumindest implizit noch innerhalb nationaler Strukturen gedacht, wird jetzt auf den ganzen Globus übertragen. Den westlichen Ländern als Vermögenden wird damit also die Rolle des Bürgertums zugewiesen, und der Rest, als sogenannte “People Of Color”, stellt das neue, globale Proletariat.
Der Haken an diesem Ansatz, natürlich: wir selbst als ganzes Land werden damit zu den Bösen. Die westlichen Gesellschaften sind im Rahmen dieses Ansatzes, globalgeschichtlich betrachtet, ebenso überholt wie das Bürgertum im 19. Jahrhundert, wir sind die privilegierte, ausbeuterische, globale Herrschaftsschicht, die nun von den ungeheuren Massen der durch unsere eigenen Kapitalaktivitäten enstandenden Armen, Vertriebenen und Flüchtlingen ebenso heimgesucht wird wie der reiche Großstadt-Kaufmann im 19. Jahrhundert von den bettelnden Kindern des von seinen eigenen Getreidespekulationen geschaffenen, städtischen Armutsproletariats. Der Wohlstand unseres Landes, die gute Infrastruktur, die kostenlose Bildung, die Gesundheitsversorgung, die gesellschaftliche Stabilität — alles, was üblicherweise als positive Errungenschaft betrachtet wurde, erscheint in diesem Licht plötzlich als moralisch fragwürdig. “Check your privilege”: es erscheint als geraubt, als durch die Kumulationsdynamik des Kapitals in unsere privilegierten Neo-Bourgeoisie-Länder gespült, angetrieben von der Ausbeutung ungeheurer, gesichtsloser Massen, die nun durch globale Migrationsbewegungen für uns überhaupt erst sichtbar werden. Expropriation der Expropriateure: die nächste Station des globalisierten Marxismus muss damit folgerichtig die revolutionäre Destruktion des Westens durch die von ihm produzierten Heere der Armen sein. Erst dadurch wird die Menschheit als Ganzes in das nächste, höhere, freiere, gerechtere Stadium eintreten können. Denn Marx ist Hegelianer, glaubt also den Sinn der Menschheit in einem fortwährenden Veränderungs- und Fortschrittsprozeß zu finden, dessen Ziel schließlich die vollkommene “Freiheit” ist. Doch während Hegel diesen Prozeß als Anwachsen der Vernunft, Freiheit durch Einsicht in die Notwendigkeit auffasst, interpretiert Marx diesen angenommenen Prozeß materialistisch: frei wird der Mensch (bzw. die Menschheit als Ganzes) durch die Veränderung, die Angleichung, der ökonomischen und wirtschaftlichen Verhältnisse.
Durchaus spielen noch eine Reihe anderer Aspekte hinein: der uralte, romantische Traum vom “Weltfrieden” (“alle Menschen werden Brüder”), den in Vergangenheit und Zukunft viele in den Sozialismus hineinprojizieren. Die Aversion gegenüber ethnischen oder nationalen Kategorien im Zuge des Holocausttraumas. Die poststrukturalistische Philosophie, worin jede westliche Wert- und Kulturbildung dekonstruiert und als Ausdruck unterdrückender Machtverhältnisse verstanden wird. Doch alle diese Aspekte bündeln sich, in die neosozialistische Theoriebildung eingewoben, zum einem grundlegenden, politischen Konflikt: maßgeblich ist nicht länger das Gemeinwohl, sondern das Allgemeinwohl. Der so agierende Politiker oder Intellektuelle setzt sich nicht länger für eine möglichst ideale Zukunft des eigenen Landes ein, sondern betrachtet sich als Anwalt eines utopischen Menschheitswohls. Ein national beschränktes Gemeinwohl als Repräsentation konkreter Bürgerinteressen wird von ihm vielmehr als unmoralisch, reaktionär, chauvinistisch aufgefasst. Man halte an überkommenen Verhältnissen fest, heißt es dann, man sei rückwärtsgewandt, man wolle die eigenen Privilegien nicht abgeben — der gesammelte Kanon sozialistischer Polemik ergießt sich nun plötzlich auf diejenigen Deutschen, die noch immer glauben, daß die Aufgabe der von ihnen gewählten Politiker darin bestünde, im Sinne des Amtseides den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren.
Die Geringschätzung des eigenen Landes als politisches Ethos ist dabei kein intellektueller Spleen, sondern längst bis in die höchsten Kreise Deutschlands vorgedrungen. Astrid Wallrabenstein ist Professorin für Öffentliches Recht in Frankfurt und seit 2020 auf Vorschlag der Grünen Richterin am Verfassungsgericht in Karlsruhe. Auf die Frage, ob IS-Kämpfer ausgebürgert werden sollten, antwortet sie: “Außerdem kann ich nicht erkennen, wie die Ausbürgerung die Sicherheitslage insgesamt verbessert. […] Der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit würde dazu führen, dass ein wahrscheinlich gefährlicher Terrorist in einem anderen Staat zur Verantwortung gezogen oder vielleicht als “Gefährder” überwacht werden müsste. Da stellt sich die Frage: Sind andere Staaten wirklich besser gerüstet, um gegen einen Terroristen vorzugehen, als wir das sind, mit unserem Strafrecht und Polizeirecht?”
Hier wird die globale Perspektive total, nicht das Gemeinwohl des verfassungsgebenden Volkes gibt den Ausschlag, sondern das der gesamten Menschheit, während die Deutschen von Frau Wallrabenstein wegen ihrer besseren Organisationsfähigkeit zum Leiden verpflichtet werden. Eine solche Aussage wird unter linken Intellektuellen gefeiert, und dennoch stellt sich die Frage, inwiefern sich diese Haltung als legitime Repräsentation des Volkswillens verstehen will, wo sie doch in aller zynischen Offenheit nicht den Nutzen, sondern den Schaden mehren will. Der Begriff “Volksverräter” mag meist unreflektiert gebraucht werden, aber: er trifft hier objektiv durchaus zu. 2015 war kein Unfall oder Zufall.
Vereinzelt scheint dieser Befund auch bereits von etablierten Politikwissenschaftlern geteilt zu werden. Philipp Manow, Professor für Politikwissenschaften in Bremen, stellt fest, daß in der jüngeren Vergangenheit nicht nur rechts- sondern auch linkspopulistische Bewegungen entstanden sind, beispielsweise Podemos in Spanien oder France Insoumise in Frankreich. Im Populismus äußert sich so verstanden keine Demokratiefeindlichkeit, sondern eine “Krise der Repräsentation”, verursacht durch eine “Entdemokratisierung der Demokratie” aufgrund einer als alternativlos kommunizierten globalistischen Elitenideologie. Dieser Globalismus äußert sich laut Manow in zwei Aspekten: zum einen neoliberal/ökonomisch in der Freizügigkeit des Kapitals, zum anderen neosozialistisch/moralisch im der Freizügigkeit von Menschen. Die Diskussion darüber wird von den Eliten auf technokratische, juristische oder rhetorische Weise dem Bereich des demokratisch Verhandelbaren entzogen. Da weder die etablierten Parteien noch die etablierten Medien gewillt sind, anti-globalistische Positionen zu vertreten, kanalisiert sich das daraus entstehende Repräsentationsdefizit in populistischen Protestbewegungen. Steht dabei die Kritik an Kapital-Freizügigkeit im Vordergrund, entstehen linkspopulistische Bewegungen, ist es dagegen Migrationskritik, sind es rechtspopulistische. [4] So daß es vielleicht gerade die Neue Rechte sein könnte, die mittels eines klugen “solidarischen Patriotismus”, worin sich die Kritik an beiden Globalisierungs-Aspekten vereint, die entscheidende System-Alternative schafft und die Völker und Nationen dieser Erde wieder zu selbstbestimmten Subjekten ihrer selbstgewählten Zukunft machen kann, statt länger in Agonie als Objekte für intellektuelle Utopien zu leiden.
5.
Doch um das Potential neurechter Theoriebildung zu nutzen, darf auf der anderen Seite nicht geleugnet werden, daß bislang mit dem Begriff des Gemeinwohls von Rechten und Wutbürgern reichlich unreflektiert umgegangen wurde. Denn die eingangs wiedergegebenen Vorwürfe treffen ja durchaus zu: eine Partei, die exklusiv glaubt, den Willen des Volkes zu vertreten, ist antidemokratisch. So wie in Bezug auf die Linke das Gemeinwohl vom Allgemeinwohl getrennt werden musste, ist auch in Bezug auf die Rechte eine grundlegende Differenzierung notwendig: das Gemeinwohl ist kein Inhalt, sondern ein ethischer Begriff — also ein Maßstab, mit dem Inhalte bewertet werden können.
Entlang der Achse der Verwechslung von Maßstab und Inhalt kann eine kritische Differenzierung rechten Denkens vorgenommen werden. Im klassischen Rechtsextremismus werden Partei und Volkswille eins, überwölbt zumeist von einem religiös aufgeladenen Führerkult, worin sich in einem einzelnen Charismatiker der Volkswille als Bewußtsein und Entscheidungskompetenz kanalisieren soll. Das Problem ist dabei aber weniger die Ablehnung von Demokratie, sondern die inhärente Überforderung: was sich hinter dem Pathos von Disziplin, Hierarchie und Ordnung, seiner organisatorischen Überwältigung wie seiner emotionalen Aufladung versteckt, ist die offene Frage nach dem konkret Umzusetzenden.
Die vom Nationalsozialismus geschaffenen Organisations- und Entscheidungsstrukturen imitieren auf geradezu rollenspielartige Weise Formationen des 19. Jahrhunderts — Aristokratie, Monarchie, Militär. Die Idealisierung der Führungsfigur und des Prinzips des Hierarchischen verdeckt dabei aber, daß die innerhalb dieser Strukturimitation zur politischen Macht Gekommenen nicht etwa lebenslang auf ihre Verantwortung vorbereitete Adelige und Offiziere sind, sondern eine organisierte Gruppe verbitterter Kleinbürger. Nicht das Volkswohl wird zur Herrschaft gebracht — denn das ist kein Inhalt, sondern ein ethischer Imperativ, der deshalb nur durch Kultur und Erziehung verinnerlicht werden kann. Zur Herrschaft kommt, was die Rechte am meisten verabscheut: eine Partei.
Es schließt sich hier auf geradezu ironische Weise der Zirkel zur Demokratiekritik des ersten Teils: der Missbrauch der Institutionen zugunsten einer Partei wird durch den Nationalsozialismus nicht abgeschafft, sondern lediglich total. Mit allen einhergehenden Begleiterscheinungen: die Auswahl der Führungspositionen erfolgt nach internen Netzwerkfähigkeiten, ideologischer Zuverlässigkeit oder skrupellosem Machthunger, doch die Frage nach fachlicher und charakterlicher Eignung wird zweitrangig. Gleichzeitig wird durch die Verwechslung von Beurteilungsmaßstab und Inhalt eine fortwährende Radikalisierung des Apparats sehr wahrscheinlich. Denn erstens erzeugen unqualifizierte Entscheider, deren Maßstab nicht die reale Folge, sondern die blind-dogmatische Abarbeitung eines ideologischen Entwurfes ist, zwangsläufig viele neue Probleme. Zweitens können diese Probleme in einem geistigen Rahmen, worin Volkswohl und Ideologie axiomatisch ineins gesetzt wird, nur durch immer weiter gesteigerte, ideologische Vehemenz gelöst werden. Da das System aus der Ineinssetzung von Ideologie und Volkswohl ja gerade seine autoritäre Selbstlegitimation zieht, kann Kritik nicht konstruktiv in den politischen Prozeß integriert, sondern muss als Subversion ausgeschlossen und vom okkupierten Rechts- und Justizsystem verfolgt werden. Parteiinterne Säuberungen, Geheimpolizei, Angst, Einschüchterung — am Ende Stagnation, Resignation in der Bevölkerung und weltfremde, paranoide Isolation bei den Eliten sind die Folge: die kommunistischen Länder zeigen, was wahrscheinlich auch aus dem Nationalsozialismus geworden wäre, hätte er sich nicht bereits im Zweiten Weltkrieg selbst zerstört.
Daß umgekehrt aber ein autoritäres Modell durchaus funktional sein kann, sofern es sich imstande zeigt, die Grenzen ideologischer Dogmatik zu überwinden, zeigt aktuell China. Die Funktionalität erweist sich allerdings darin, daß die chinesische Führung gerade das antizipieren musste, was sie ideologisch maßgeblich bekämpfte, nämlich Kapitalismus, Marktwirtschaft, Privateigentum. Um dazu imstande zu sein, war es notwendig, die offizielle Parteiideologie zu transzendieren, sozialistische und kapitalistische Elemente sachlich in Bezug auf ihre gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen hin zu untersuchen und in ihren jeweils positiven Aspekten zu nutzen. Kurz gesagt: der Kommunistischen Partei Chinas ist es gelungen, einen Maßstab des Gemeinwohls zu etablieren.
Nur muss jetzt die Parteiorganisation, die nur noch dem Namen nach kommunistisch ist, intern das leisten, was in einem demokratischen Land das zusammengewürfelte Parlament leistet: alle möglichen Standpunkte und Alternativen abzubilden und politische Entscheidungen aushandeln. Sie muss Organisationsstrukturen schaffen, worin Informationen verarbeitet und Entscheidungen getroffen werden, sie muss bei ihren Parteimitgliedern einen Geist kultivieren, bei der weniger eine kommunistische Parteidoktrin, sondern der Nutzen für die Zukunft des Landes im Mittelpunkt steht. Bzw: sie muss Hierarchien und eine Ausbildung schaffen, die eine Auswahl von Parteimitgliedern ermöglicht, die diese Charaktermerkmale vorbildlich verkörpern. (Ich werde im dritten Teil dieser Artikelreihe dann abschließend auf die Frage nach Organisation und Erziehung, die sich hier nun gegen Ende des zweiten Teils langsam aufdrängt, näher eingehen.)
Stellen wir also China, die DDR und den Nationalsozialismus in ihrer organisatorischen Verwandtschaft nebeneinander, öffnet sich eine interessante Betrachtungsebene. Es wird sichtbar, daß wir nicht ausschließlich unter Strukturentscheidungen zu wählen haben. Die Schwächen der Demokratie werden nicht quasi-automatisch durch eine autoritäre Organisation des Staates behoben, wie viele Rechte annehmen. Umgekehrt bedeuten aber die Schrecken und Schwächen autoritärer Systeme auch nicht, daß Demokratie ein jeder Kritik enthobener Selbstläufer ist, wie der Liberale glaubt. Weder die hierarchische Organisationsstruktur des Autoritarismus noch die als sich selbstregulierendes, freies Spiel aller Kräfte gedachte Demokratie garantiert struktruell-automatisch gute Politik.
Funktionale Demokratie und funktionaler Autoritarismus teilen vielmehr ein gemeinsames Merkmal: die Fähigkeit, einen unabhängigen Maßstab des Gemeinwohls zu etablieren, dem ideologische Dogmen wie auch Klassen- und Individualinteressen untergeordnet werden. Bismarck und der preußische Adel waren dazu imstande, weshalb diese Zeit trotz ihrer mangelnden politischen Selbstbestimmung bis heute als Vorbild wirksam ist.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts aber gerät der Rechte zunehmend in die Mühle modernistischen Denkens und unterwirft sich ihm, ohne das bislang selbst zu bemerken: statt weiterhin auf seinem überparteilichen Ethos zu beharren, beginnt er im eigentlich ja abgelehnten demokratisch-pluralen Rahmen sein Denken als Pseudo-Ideologie zu verformen und tritt schließlich mit einer eigenen Pseudo-Partei, die in ihren Idealen, ihrer Art des Denkens nur wenig mit den anderen Parteien zu tun hat, zum Wettkampf in der modernen Ideen-Arena an. Damit verliert er aber das aus den Augen, was ihn eigentlich politisch antreibt, worin seine innere, gefühlte Wahrheit besteht: der Wunsch des Wiedererstehens einer traditionalistischen, normintegrierten Gesellschaft, die von Zusammenhalt und Gemeinwohl geprägt ist, degeneriert zu einer Variante des politischen Totalitarismus, womit einer bereits ethisch und ideologisch zersplitterten Gesellschaft der Zusammenhalt als äußere, autoritäre Struktur aufgezwungen werden soll.
Bis heute ist dieses Scheitern in seinem theoretischen Zusammenhang nicht aufgearbeitet worden. Das hat zur Folge, daß weder die Neue Rechte als partielles Reformprojekt noch der Rechtspopulismus als volkstümlich-instinkthaft geprägte Bewegung das Wahre, das Richtige, das im Kontext einer verfallenden Neo-Demokratie für unsere Zeit Notwendige formulieren, ja, noch nicht einmal denken können. Stattdessen entsteht hilflose Aggressivität, ziellose Wut, die, wie gesehen, im Kern durchaus legitim ist — bei deren destruktiver Blindheit aber immer nachvollziehbar bleibt, wieso sie vom Staat bekämpft wird. Möglicherweise kann die Rechte die westliche Kultur retten, statt ihr als ihr ewiger Idiot ins Grab zu folgen, doch sie wird sich dafür geistig weiterentwickeln müssen. Was bedeutet: um zu verhindern, daß die Allgemeinwohlorientierung der herrschenden, von linker Theorie geprägten Eliten den Westen zerstört, muss die Rechte als ihr Antagonist begreifen, daß das Volkswohl kein politischer Inhalt sein kann, sondern ein notwendiger Maßstab politischer Ethik ist, den es neu zu etablieren gilt.
6.: Ausblick
Natürlich steht dabei die Rechte seit 100 Jahren vor einem grundlegenden Problem: durch die wachsende Fragmentierung der Moderne werden die Bedingungen für die Möglichkeit einer gemeinwohlorientierten Erziehung, bzw. eines gemeinwohlorientierten politischen Kultur überhaupt immer geringer. Individualistische, rationalistische, soziologische und ökonomistische Motive ersetzen das preußische Ethos der Ein- und Unterordnung unter das gemeinschaftliche Ganze, des Volkes, der Nation, der Kultur, der Religion. Die Massengesellschaft mit ihrer epikureischen Massenmoral ersetzt die aristokratische Ethik — viele rechte Autoren, von Nietzsche über Evola bis Benoist haben den Befund getroffen, doch nie eine überzeugende Antwort formulieren können.
Wir sind diejenigen, die in dieser Sphäre aufgewachsen sind und wir finden nichts Lebendiges, nichts Gelebtes mehr vor, auf das wir bauen könnten. Im Gegenteil, wir finden uns selbst wieder als Ausgestoßene, als vom eigenen Land Befeindete und Beschimpfte, und alles, woran uns liegt, wird verhöhnt und als wertlos und rückwärtsgewandt verlacht. Dem Rechten fällt es heute schwer, sein eigenes Volk zu lieben, und es nimmt nicht wunder, daß viele sich ins Private zurückziehen, oder das gegenwärtige Geschehen nur noch aus einem oberflächlich zynischen, innerlich aber doch ziemlich hilflosen und verzweifelten Akzelerationismus heraus betrachten können. Ich selbst bin nicht gewillt, mich damit zufriedenzugeben. Wie also innerhalb eines leeren Raumes, eines kulturellen Nullpunktes ein System schaffen, das nicht inhaltliche Oktroyation oder strukturellen Zwang erzeugt, sondern Charaktere bildet? Die Frage versucht auch Spengler bereits in “Neubau des Deutschen Reiches” 1924 zu beantworten, um sie wird es sich im dritten und abschließenden Teil meiner Artikelreihe drehen. Es lebe das Heilige Deutschland.
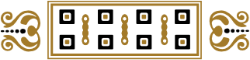
Fußnoten:
“Und nun ging es an die soziale Reformarbeit. Schon in der Thronrede vom 15. Februar 1881 und noch deutlicher in der Botschaft vom 17. November desselben Jahres wurde sie [von Kaiser Wilhelm I.] angekündigt. Hier hieß es: ‘Schon im Februar dieses Jahres haben wir Unsere Überzeugung aussprechen lassen, daß die Heilung der sozialen Schäden nicht ausschließlich auf dem Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig auf dem der positiven Förderung des Wohles der Arbeiter zu suchen sein werde. Wir halten es für Unsere Kaiserliche Pflicht, dem Reichstag diese Aufgabe von neuem ans Herz zu legen, und würden mit um so größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott Unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es Uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterlande neue und dauernde Bürgschaften seines inneren Friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen.’
Und in der Botschaft vom 14. April 1883 wurde dann noch einmal der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß ‘die Gesetzgebung sich nicht auf die polizeilichen und strafrechtlichen Maßregeln zur Unterdrückung und Abwehr staatsgefährlicher Umtriebe beschränken dürfe, sondern suchen müsse, zur Heilung oder doch zur Minderung des in dem Straßgesetz bekämpften Übels Reformen einzuführen, welche das Wohl der Arbeiter zu fördern und die Lage derselben zu bessern und zu sichern geeignet sind.’. Angesicht seines hohen Alters mahnte der Kaiser ausdrücklich zur Eile: solange Gott ihm Frist gebe, wolle er ‘kein in seiner Macht stehendes Mittel versäumen, um die Besserung der Lage der Arbeiter und den Frieden der Berufsklassen untereinander zu fördern.’ ” (Theobald Ziegler, Die geistigen und sozialen Strömungen Deutschlands im 19. Jahrhundert, Berlin 1911)
Darin liegt selbstverständlich ein nicht unerheblicher Anteil von machtpolitischem Kalkül — unsere vielen marxistisch orientierten Historiker betonen das nicht ganz zu unrecht. Und dennoch kann wohl zugestanden werden, daß hier das Ziel tatsächlich darin bestand, durch überparteiliches, gerechtes Abwägen die Stabilität des Landes zu gewährleisten.
Ich selbst verwende den Begriff “Volk” hier in einem völlig neutralen Sinn, es macht für die Argumentation, die Herleitung des Gemeinwohls keinen Unterschied, ob damit eine rechte “Abstammungsgemeinschaft”, ein liberaler “civic nationalism”, der sich über den Passbesitz definiert oder auch ein neulinkes “alle, die sich zufälligerweise gerade innerhalb dieser zufällig gezogenen, reaktionären Grenzen aufhalten” gemeint ist. Maßgeblich ist lediglich, daß eine wie auch immer geartete Gruppe einen wie auch immer gearteten Modus entwirft, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
Für die Neosozialisten indes ist der Kapitalismus nicht einfach der Feind, sondern vielmehr die notwendige Vorstufe zum Sozialismus. Der Kapitalismus hat, ganz im Sinne des Kommunistischen Manifestes von Marx und Engels “alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. [Die Bourgeoisie] hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose “bare Zahlung”. […] Sie hat, mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.” Anders gesagt: indem der enthemmte Neoliberalismus alle bestehenden kulturellen und politischen Strukturen vernichtet, alle traditionellen, wertintegrierten Systeme auflöst, wird die Weltmenschheit als sozialistische Gleichheits- und Harmonieutopie überhaupt erst möglich. Er zerstört historisch gewachsene Identitäten, Werte und Bindungen als bloß idealistische “Illusionen” und erzeugt so eine ausgebeutete, wütende Menschheits-Masse als ökonomisch-materialistische Realität, die schließlich zur Revolution schreitet, um das kapitalistische System final zu zerschlagen. Unter Schlagworten wie “Universalismus”, wie “westliche Werte”, wie “Freiheit” oder “Freizügigkeit” haben im Prinzip also die Neosozialisten die in den letzten Jahrzehnten entstandenen neoliberalen Strukturen unterwandert, nutzen dessen demokratieskeptische, technokratische Enthobenheit wie auch dessen naiven Fortschritts-Stumpfsinn und fordern nun, nachdem die neoliberale Transformation des Planeten sich der Vollendung nähert, den Kopf des Westens als finale Gerechtigkeit und geschichtlichen Fortschritt. Nach der Genese des Wohlstands die revolutionäre Zerschlagung und Umverteilung des Wohlstands, so lautet die materialistische Dialektik. Und wenn nun beim Technokraten-Treffen in Davos mittlerweile Greta Thunberg oder Flüchtlingsaktivisten teilnehmen — Kräfte also, für die Wirtschaftskritik und Umverteilung im Mittelpunkt stehen -, hat unter der Oberfläche ein Wandel stattgefunden, der von Philipp Manow in seiner Grundsätzlichkeit überhaupt nicht erkannt wird.
